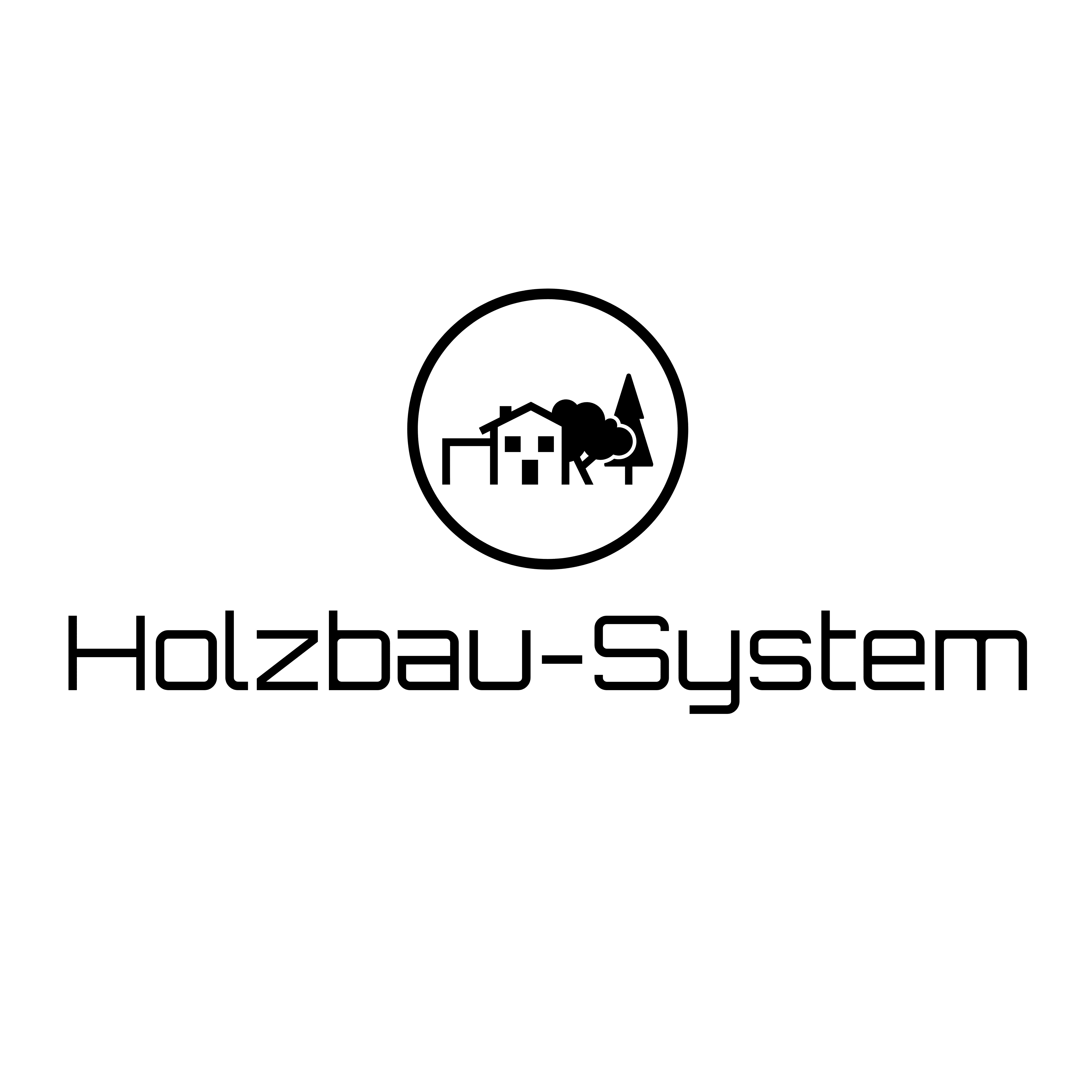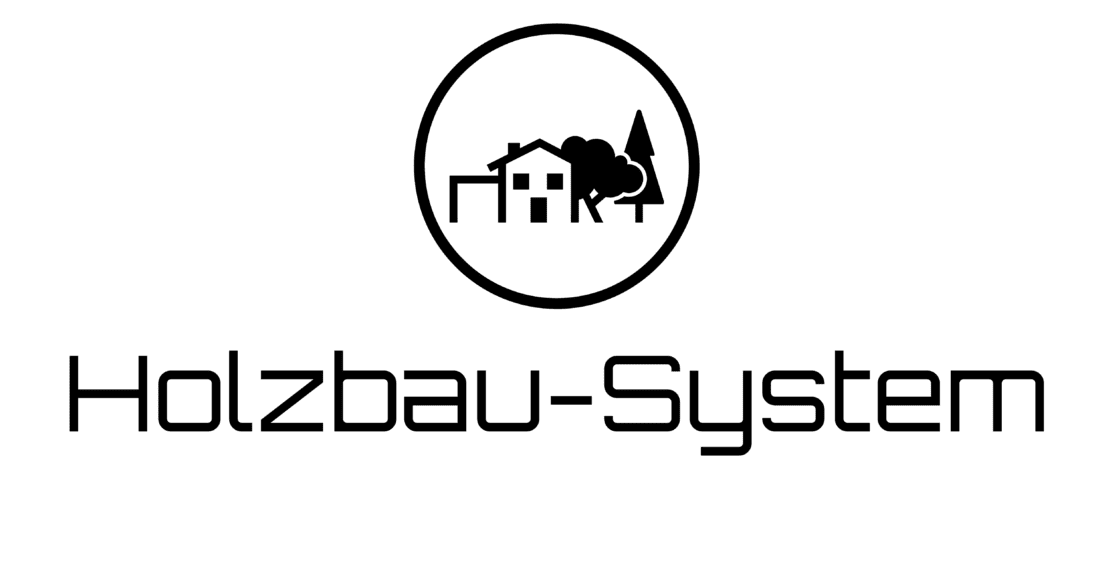Von: Yannick Wild (Bauingenieur, Holzbauingenieur)
Stand: 29.09.2024
Brandschutz im Holzbau
In den vergangenen Jahren haben tragische Brände immer wieder Schlagzeilen gemacht und gezeigt, wie wichtig ein effektiver Brandschutz im Wohnhausbau ist. Ein konstruktiver Brandschutz ist dabei unerlässlich, um im Ernstfall Menschenleben und Gebäude zu schützen. Doch was genau versteht man unter einem konstruktiven Brandschutz und welche Maßnahmen sind im Wohnhausbau erforderlich?
Das wichtigste in Kürze:
- Holz hat ein berechenbares Brandverhalten
- Brandschutzmaßnahmen im Holzbau umfassen schwer entflammbare Baustoffe, Verkleidungen und dimensionierte Holzquerschnitte.
- Tragende Holzkonstruktionen können mit Gipsfaserplatten verkleidet oder so dimensioniert werden, dass sie trotz Abbrand stabil bleiben.
- Gute Planung sorgt für sicheren Brandschutz, effektive Rettungswege und Schutz vor Brandausbreitung.
- Holzbau ist dank moderner Brandschutztechniken in Deutschland flächendeckend zugelassen.
Warum ist Brandschutz im Holzbau wichtig?
Um die Sicherheit im Holzbau zu gewährleisten, ist es wichtig, den Brandverlauf und dessen Auswirkungen auf Holzkonstruktionen zu verstehen. Holz als Baustoff weist spezifische Eigenschaften im Brandfall auf, die sorgfältig in die Planung integriert werden müssen. Mit gezielten Brandschutzmaßnahmen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften können stabile und sichere Holzbauwerke geschaffen werden, die den geltenden Brandschutzanforderungen entsprechen. Der Brandschutz im Holzbau trägt so nicht nur zur Sicherheit, sondern auch zur Langlebigkeit von Holzgebäuden bei.
Haftungshinweis :
Bei den folgenden Artikel handelt es sich um allgemeine Informationen,
welche nach bestem Wissen und Gewissen
und nach gründlichen Recherchen erstellt wurden. Irrtümer oder Fehler, welche sich aus veränderten Randbedingungen
ergeben könnten, sind dennoch nicht aus-
geschlossen, so dass der Verfasser keiner-lei Haftung übernehmen kann.
Eine Brandschutzbeurteilung sollte immer von einem Fachplaner individuell auf das jeweilige Projekt vorgenommen werden.
Brandverlauf in drei Phasen
Ein typischer Brandverlauf in einem Wohngebäude wird in drei Phasen eingeteilt, die auch für den Holzbau relevant sind.
1. Phase – Brandentstehung:
In den ersten fünf Minuten entsteht lokaler Rauch, der sich schnell im Gebäude verteilt. Die hohe CO2-Konzentration kann schnell zu Bewusstlosigkeit führen, weshalb die Selbstrettung in dieser Phase entscheidend ist.
2. Phase – Kritischer Punkt:
Nach etwa 10 Minuten steigt die Temperatur erheblich, und Bewohner sind auf fremde Hilfe angewiesen.
3. Phase – Flashover:
Nach ca. 15 Minuten kann der sogenannte „Flashover“ auftreten, bei dem sich der Rauch schlagartig entzündet. Hier ist die Feuerwehr besonders gefordert, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern.
Ziele des Brandschutz
Basierend auf dem Brandverlauf definiert die Musterbauordnung vier Schutzziele für Gebäude. Diese sollen nicht jeden Brand vollständig verhindern, sondern ein gesellschaftlich akzeptiertes Sicherheitsniveau bieten.
1. Vorbeugung der Brandentstehung:
Durch den Einsatz von CE-zertifizierten Geräten, Sicherungstechniken (z.B. FI-Schalter) und schwer entflammbaren Baustoffen wird die Brandentstehung reduziert.
2. Verhinderung der Brandausbreitung:
Vorgeschriebene feuerhemmende Materialien und Konstruktionen minimieren die Ausbreitung des Feuers.
3. Rettung von Menschen und Tieren:
Gesetzliche Vorgaben für Flucht- und Rettungswege sorgen für schnelle Evakuierung.
4. Ermöglichung von Löscharbeiten:
Eine gute Zugänglichkeit für Rettungskräfte erleichtert effektive Löschmaßnahmen.
Brandschutzregelungen im Hochbau – Überblick
Die Regelungen zum Brandschutz im Holzbau basieren auf der Musterbauordnung (MBO) und werden durch die jeweilige Landesbauordnung (LBO) der Bundesländer ergänzt. Dabei unterscheidet sich der Brandschutz je nach Gebäudeklasse (1 bis 5). In Bayern orientiert sich die Bayrische Bauordnung (BayBO) daran:
Gebäudeklassen als Grundlage der Sicherheitsanforderungen
Gebäudeklassen dienen der Einteilung von Bauwerken nach ihrer Größe, Nutzung und Gefährdungspotenzial. Sie sind ein zentraler Bestandteil der Bauordnung, da sie bestimmen, welche Brandschutzmaßnahmen erforderlich sind, um Bewohner und Nutzer im Ernstfall zu schützen. Je höher die Gebäudeklasse, desto strenger die Anforderungen an Materialien und Konstruktionen, um Brandausbreitung zu verhindern und Rettungswege sicherzustellen.
Gebäudeklasse 1:
Freistehende Gebäude bis 7 m Höhe mit maximal 2 Nutzungseinheiten bis 400 m². Hier gelten keine Anforderungen an tragende Bauteile, da die Gefahr gering und die Rettung einfach ist.
Gebäudeklasse 2:
Gebäude bis 7 m Höhe mit bis zu 2 Nutzungseinheiten und max. 400 m². Feuerhemmende Bauteile sind erforderlich, um die Brandausbreitung zu verzögern.
Gebäudeklasse 3:
Sonstige Gebäude bis 7 m Höhe. Feuerhemmende Materialien sind ebenfalls vorgeschrieben, jedoch können je nach Nutzung zusätzliche Anforderungen bestehen.
Gebäudeklasse 4:
Gebäude bis 13 m Höhe mit Einheiten bis 400 m². Erhöhte Brandschutzanforderungen wie feuerbeständige Bauteile (30–60 Minuten Feuerwiderstand) sind notwendig, um eine ausreichende Rettungszeit zu gewährleisten.
Gebäudeklasse 5:
Gebäude zwischen 13–22 m Höhe. Diese erfordern den höchsten Brandschutz, einschließlich feuerbeständiger Bauteile, die mindestens 60 Minuten einem Brand standhalten müssen.
Sonderbauten wie Hochhäuser und öffentliche Einrichtungen unterliegen noch strengeren Brandschutzvorschriften.
Für private Bauherren sind vor allem die Klassen 1–3 relevant. Obwohl die Anforderungen in diesen Klassen noch relativ gering sind, ist eine sorgfältige Planung essenziell, um den vorgeschriebenen Schutz sicherzustellen.
Baustoffklassen und Feuerwiderstandsklassen
Die BayBo regelt in Artikel 24 (1) und (2) die Bezeichnungen der zu verwendenden Materialien.
Baustoffklassen nach DIN 4102-1:
- Nichtbrennbare Baustoffe:
- Klasse A1: (Beton, Mauerwerk, Stahl*)
- Klasse A2: Enthält geringe brennbare Anteile (Mineralfaser-Dämmstoffe, Gipskarton-Feuerschutzplatten – GKF)
- Brennbare Baustoffe:
- Klasse B1: Schwer entflammbar (Gipskartonplatten, Spanplatten)
- Klasse B2: Normal entflammbar (Holz > 2mm Dicke, Dachpappen)
Feuerwiderstandsklassen der Bauteile:
- Feuerbeständig (F90): 90 Minuten Widerstand, Verwendung von A1/A2-Baustoffen.
- Hochfeuerhemmend (F60): 60 Minuten Widerstand, mit A1/A2 sowie Teilen B1/B2.
- Feuerhemmend (F30): 30 Minuten Widerstand, größere Anteile B1/B2.
Diese Begriffe sind entscheidend, um die Brandsicherheit im Holzbau zu gewährleisten und richtig zu planen.
* Stahl gilt zwar als nicht brennbar, jedoch müssen auf Grund der Wärmeleitfähigkeit und des Schmelzverhalten im Brandfall besondere Maßnahmen getroffen werden.
Brandverhalten von Holzbauten – Mythen und Realität
Holz wird als brennbares Material eingestuft, was lange Zeit als Argument gegen den Holzbau verwendet wurde. Doch Forschungsarbeiten und Praxiserfahrungen, besonders aus Österreich, haben gezeigt, dass Holz bestimmte Vorteile im Brandverhalten hat.
Wärmeleitfähigkeit: Holz leitet Wärme sehr langsam, was bedeutet, dass die Hitze im Brandfall nur langsam ins Innere eindringt. Diese Eigenschaft verzögert die Entzündung des Holzes im Vergleich zu Stahl, der Hitze schnell aufnimmt und seine Stabilität verliert.
Selbstschutz durch Verkohlung: Holz bildet beim Brennen eine Kohleschicht, die die Sauerstoffzufuhr reduziert und den Abbrand verlangsamt. Diese Schutzschicht ist entscheidend für die Stabilität von Holzkonstruktionen im Brandfall.
Diese Eigenschaften machen den Abbrand von Holz berechenbar und kontrollierbar, weshalb der Holzbau mittlerweile auch in Deutschland flächendeckend zugelassen ist.
Moderne Lösungen für ein gutes Brandschutzkonzept
Um den Brandschutz im Holzbau zu gewährleisten gibt zwei konstruktive Ansätze mit jeweils eigenen Vor- und Nachteilen.
Zum einen ein sogenanntes Kapselkriterium, welches tragende Holzbauteile durch das verschalen von nicht oder kaum brennbaren Baustoffen vorsieht. In den meisten fällen werden dabei z.B. Stützen durch Gipsfaserplatten so umhüllt, das die Hitze für die vorgesehene Zeit nicht in das Holz vordringen kann und diese seine volle Tragfähigkeit beibehält. Allerdings möchten viele Bauherren ihr Holzkonstruktion zur Schau stellen und nicht unter einer dicken Gipsschicht verstecken. Hierzu gibt es den zweiten Ansatz, den Nachweis auf Abbrand, hierbei wird ermittelt wie sich der Querschnitt eines Holzbauteils unter Abbrand verringert. Der Querschnitt wird dann so gewählt, das er auch bei Abbrand die auf ihn wirkende Lasten abtragen kann ohne zu Versagen. Der Nachteil dabei ist jedoch, dass der Querschnitt bei dem nicht eintreten eines Brandes deutlich überdimensioniert ist. Zudem müssen die Verbindungsmittel die meist aus Eisenwerkstoffen bestehen besonders geschützt werden, da diese wie vorhin beschrieben deutlich eher Versagen würden.
Brandschutz im Holzbau – Kapselkriterium vs. Nachweis auf Abbrand
Es gibt zwei Ansätze für den Brandschutz im Holzbau:
Kapselkriterium: Hier werden tragende Holzkonstruktionen mit nicht brennbaren Materialien, wie Gipsfaserplatten, verkleidet. Dadurch bleibt das Holz vor Hitze geschützt und behält seine Tragfähigkeit, ist aber optisch verdeckt.
Nachweis auf Abbrand: Bei diesem Ansatz wird der Holzquerschnitt so dimensioniert, dass er auch bei Abbrand die Lasten trägt. Der Vorteil ist die Sichtbarkeit der Holzkonstruktion, der Nachteil ist jedoch ein oft überdimensionierter Querschnitt und empfindlichere Metallverbindungen.
Allerdings ist in den Gebäudeklassen 1-3 die Dimensionierung des Holzquerschnitts häufig nicht allein durch den Brandschutz vorgegeben. Vielmehr beeinflussen Schall- und Wärmeschutzeigenschaften die Auswahl der Querschnitte für Decken und Wände. Dies bietet Spielraum für Bauherren, die auf den sichtbaren Holzbau Wert legen. Übrigens finden Sie hier mehr Informationen zu Decken in Holzbauweise, um sich ein besseres Bild von den möglichen Lösungen und deren Vorteilen im Holzbau zu machen.
Wie sich ein Holzhaus im Brand verhält sehen Sie im folgendem Video.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=J2_A9kBFTh0 , Kanalbetreiber : BR24
Fazit
Ein effektiver Brandschutz im Wohnhausbau erfordert eine ganzheitliche Betrachtung und Planung bereits in der Planungsphase. Hier sollten und Architekten eng mit Brandschutzexperten zusammenarbeiten, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Denn nur so kann im Ernstfall ein konstruktiver Brandschutz Leben retten und ein Wohnhaus schützen.
Holz ist brennbar, aber es brennt gleichmäßig und bildet eine schützende Kohleschicht, die das Holz stabil hält und die Ausbreitung verlangsamt. Dadurch ist das Brandverhalten berechenbar, was einen wichtigen Vorteil im Vergleich zu anderen Baustoffen biete
s gibt zwei Ansätze: das „Kapselkriterium“, bei dem Holz mit nicht brennbaren Materialien verkleidet wird, und den „Nachweis auf Abbrand“, bei dem Holzquerschnitte so dimensioniert werden, dass sie auch im Brandfall tragfähig bleiben.
Holz hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit und bildet eine schützende Kohleschicht, wodurch es länger stabil bleibt als andere Materialien wie Stahl, das seine Tragfähigkeit bei hohen Temperaturen schneller verliert.
In Gebäudeklassen 1-3 sind die Brandschutzanforderungen geringer, oft müssen lediglich feuerhemmende Bauteile (F30) verwendet werden. Bei diesen Gebäuden spielen oft Schall- und Wärmeschutz bei der Dimensionierung der Holzelemente eine größere Rolle.
Ja, Stahl verliert bei hohen Temperaturen schnell seine Stabilität, während Holz durch den Verkohlungseffekt eine Schutzschicht bildet, die den Brandverlauf verlangsamt und die Struktur stabiler hält.
Ja, Holzbauten sind in Deutschland offiziell zugelassen. Durch Forschung und Erfahrung wurden die Brandverhaltenseigenschaften von Holz umfassend untersucht und in den Bauregeln berücksichtigt.
Sie benötigen Hilfe oder haben Fragen?